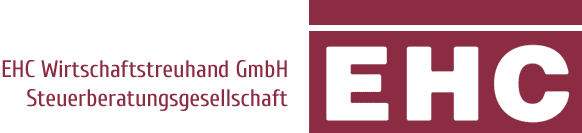
08:00 – 12:00 Uhr
12:30 - 15:00 Uhr
Freitag:
08:00 – 12:00 Uhr
+43 (0) 2266 / 628 70-0
office@ehc-wt.com
Erfahrung hebt Chancen
Familienbetrieb seit 1954
Unverbindliche & kostenfreie Erstberatung
+43 (0) 2266 / 628 70-0
Aktuelles
Wie können fälschlich bezogene Corona-Zuschüsse richtiggestellt werden?
Fehler oder falsche Angaben in Anträgen auf Corona-Unterstützungsleistungen des Bundes können nun mittels Korrekturmeldung richtiggestellt werden.
Der unberechtigte Bezug der verschiedenen Corona-Unterstützungsleistungen kann nicht nur eine Rückforderung der bereits ausbezahlten Zuschüsse, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Um das Risiko für Unternehmen, die ihre Anträge angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie oft unter erheblichem Zeitdruck vorbereiten mussten, zu senken, wurde nun die Möglichkeit geschaffen, Fehler oder falsche Angaben bei der Antragstellung an die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) durch eine Korrekturmeldung zu beheben.
Die Möglichkeit einer Korrekturmeldung besteht für finanzielle Zuschüsse des Bundes, die von der COFAG ausbezahlt werden, also
- Lockdown-Umsatzersatz I und Lockdown-Umsatzersatz II,
-
Ausfallsbonus,
- Verlustersatz,
- Fixkostenzuschuss I und Fixkostenzuschuss 800.000.
Der erhaltene Zuschuss muss in dem Ausmaß, in dem er unrechtmäßig erhalten wurde, an die COFAG zurückgezahlt werden. Das gilt auch für Fälle, in denen die Anspruchsberechtigung überhaupt fehlt und folglich der gesamte Zuschuss rückgezahlt werden muss.
Eine vollständige und inhaltlich richtige Korrekturmeldung befreit ansonsten aber von weiteren Strafen oder Sanktionen.
Wie läuft eine Korrekturmeldung ab?
- Voraussetzung ist, dass der beantragte Zuschuss bereits zur Gänze an das Unternehmen ausbezahlt worden ist. Bei Zuschüssen, die in mehreren Tranchen ausbezahlt werden (z.B. Ausfallsbonus), muss das Unternehmen bereits alle Tranchen beantragt und erhalten haben.
- Im ersten Schritt muss der erhaltene Zuschuss in dem Ausmaß, in dem er zu Unrecht bezogen wurde, an die COFAG rücküberwiesen werden.
- Erst im zweiten Schritt wird die eigentliche Korrekturmeldung mittels eines Online-Formulars erstattet (beachten Sie, dass beim Ausfallsbonus für jeden in Anspruch genommenen Monat eine gesonderte Korrekturmeldung notwendig ist).
- Sie werden anschließend per E-Mail verständigt, sobald die Korrekturmeldung bearbeitet wurde.
Welche Neuerungen bringen „Ausfallsbonus II“, „Verlustersatz verlängert“ und „Härtefallfonds Phase 3“?
Die angekündigte Verlängerung bestimmter Corona-Unterstützungsleistungen wurde nun auch in die jeweiligen Förderrichtlinien eingearbeitet.
Die bereits seit längerem angekündigte Verlängerung und Anpassung bestimmter Corona-Unterstützungsleistungen hat inzwischen auch Einzug in die zugrunde liegenden Regelwerke gehalten. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Neuerungen für Sie zusammengefasst.
„Ausfallsbonus II“
Der Ausfallsbonus wurde um drei Betrachtungszeiträume verlängert:
- Betrachtungszeitraum Juli 2021 mit dem Vergleichszeitraum Juli 2019 und einer Antragsfrist von 16.8.2021 bis 15.11.2021;
- Betrachtungszeitraum August 2021 mit dem Vergleichszeitraum August 2019 und einer Antragsfrist von 16.9.2021 bis 15.12.2021;
- Betrachtungszeitraum September 2021 mit dem Vergleichszeitraum September 2019 und einer Antragsfrist von 16.10.2021 bis 15.1.2022.
Bemessungsgrundlage des „Ausfallsbonus II“ ist weiterhin der Umsatzausfall im jeweiligen Betrachtungszeitraum. Um für die neuen Betrachtungszeiträume antragsberechtigt zu sein, muss dieser nun allerdings 50 % (statt bisher 40 %) betragen.
Der Fördersatz ist nicht mehr länger einheitlich, sondern beträgt branchenabhängig zwischen 10 % und 40 %. Ausschlaggebend für die Einstufung ist dabei die ÖNACE-Kennzahl der Branche, in der das Unternehmen während eines Betrachtungszeitraums überwiegend zur Erwirtschaftung seiner Umsätze tätig war. Der Förderhöchstbetrag für die neuen Betrachtungszeiträume beträgt € 80.000,00 monatlich. Ausbezahlte Kurzarbeitsbeihilfen können sich allerdings auf die Höhe des tatsächlich ausbezahlten „Ausfallsbonus II“ auswirken.
Neu sind außerdem bestimmte Vorgaben hinsichtlich der Erhaltung des Mitarbeiterstandes, der Entnahmen und Gewinnausschüttungen sowie der Vergütungen.
Beachten Sie, dass der in der ersten Phase des Ausfallsbonus vorgesehene Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000 im Rahmen des „Ausfallsbonus II“ nicht mehr beantragt werden kann.
„Verlustersatz verlängert“
Der Verlustersatz wurde um sechs einmonatige Betrachtungszeiträume von Juli 2021 bis Dezember 2021 verlängert. Dabei kann der „Verlustersatz verlängert“ für beliebig viele dieser neuen Betrachtungszeiträume beantragt werden, solange sie zeitlich zusammenhängen. Eine Lücke ist nur zu Betrachtungszeiträumen vor dem Juli 2021 möglich.
Um für die neuen Betrachtungszeiträume antragsberechtigt zu sein, muss der erlittene Umsatzausfall mindestens 50 % (statt bisher 30 %) betragen.
Der „Verlustersatz verlängert“ kann in bis zu zwei Tranchen beantragt werden, wobei im Rahmen der ersten Tranche 70 % des voraussichtlichen Zuschusses und im Rahmen der zweiten Tranche der verbleibende Restbetrag ausbezahlt wird. Es kann aber auch der gesamte Zuschuss erst im Rahmen der zweiten Tranche beantragt werden.
Anträge auf die erste Tranche können von 16.8.2021 bis 31.12.2021 gestellt werden, Anträge auf die zweite Tranche sind anschließend von 1.1.2022 bis 30.6.2022 möglich.
„Härtefallfonds Phase 3“
Der Härtefallfonds wurde um drei einmonatige Betrachtungszeiträume von Juli 2021 bis September 2021 verlängert. Die neuen Betrachtungszeiträume laufen dabei nicht wie bisher vom 16. eines Monats bis zum 15. des Folgemonats, sondern vom Monatsersten bis zum Monatsletzten. Anträge für einen Betrachtungszeitraum können ab Beginn des Folgemonats bis spätestens 31.12.2021 gestellt werden. Für die Antragstellung ist eine Handysignatur notwendig.
Der Zuschuss beträgt in der dritten Phase des Härtefallfonds mindestens € 600,00 und höchstens € 2.000,00 pro Betrachtungszeitraum.
Beachten Sie, dass Anträge im Rahmen der Phase 2 sind nicht mehr länger möglich sind!
Weiterführende Informationen zum „Härtefallfonds Phase 2“ erhalten Sie unter https://www.wko.at/service/haertefall-fonds.html.
„Ausfallsbonus“: Was gilt neu für den Betrachtungszeitraum März?
Der „Ausfallsbonus“ soll Unternehmen, deren Umsätze im jeweiligen Betrachtungszeitraum um mindestens 40 % zurückgegangen sind, mit zusätzlicher Liquidität versorgen. Die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen der „Ausfallsbonus“ gewährt werden kann, sind in einer umfangreichen Förderrichtlinie geregelt. Die wesentlichen Eckpunkte dieser Förderrichtlinie finden Sie in unserem Steuernews-Beitrag „Coronavirus: Was bringt der neue Ausfallsbonus?“.
Der Bundesminister für Finanzen hat nunmehr angekündigt, dass der „Ausfallsbonus“ für den Betrachtungszeitraum März 2021 deutlich erhöht werden soll.
Erhöhter „Ausfallsbonus“
Sofern ein Unternehmen sämtliche Voraussetzungen für die Gewährung eines „Ausfallsbonus“ erfüllt, gilt im Betrachtungszeitraum März 2021, dass
- der eigentliche Bonus für diesen Betrachtungszeitraum auf 30 % (statt 15 %) des Umsatzausfalles und
- die Obergrenze des eigentlichen Bonus auf € 50.000,00 (statt € 30.000,00) pro Unternehmen
angehoben wird.
Der optionale Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000, der im Rahmen des „Ausfallsbonus“ zusätzlich zum eigentlichen Bonus beantragt werden kann, bleibt hingegen unverändert bei 15 % des Umsatzausfalles mit einer Obergrenze von € 30.000,00 pro Unternehmen.
Für den Betrachtungszeitraum März 2021 ergeben sich daraus (bei Inanspruchnahme des optionalen Vorschusses auf den Fixkostenzuschuss 800.000) eine maximale Ersatzrate von 45 % des Umsatzausfalles und ein Förderhöchstbetrag von € 80.000,00 pro Unternehmen.
Antragstellung über FinanzOnline
Der erhöhte „Ausfallsbonus“ für den Betrachtungszeitraum März 2021 kann ab dem 16.4.2021 elektronisch über FinanzOnline beantragt werden. Der Antragsteller kann seinen Antrag entweder selbst einbringen oder von einem bevollmächtigten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter einbringen lassen.
Hinweis
Diese Informationen sind auf dem Stand vom 11.3.2021 und können sich kurzfristig ändern. Zudem sind die zu berücksichtigenden Regelungen, Voraussetzungen und Einschränkungen besonders umfangreich und müssen stets für den jeweiligen Einzelfall geprüft werden.
Coronavirus: Welche Ersatzansprüche können bei behördlicher Absonderung bestehen?
Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder bei denen die Gefahr einer Ansteckung besteht, werden von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mittels Bescheid behördlich abgesondert. Selbständig Erwerbstätige (einschließlich nach dem GSVG pflichtversicherte Gesellschafter einer Personengesellschaft), die behördlich abgesondert werden, können innerhalb von drei Monaten ab dem Ende der Absonderung den Ersatz des dadurch entgangenen Verdienstes bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft) beantragen. Ist hingegen ein Arbeitnehmer des Selbständigen von einer behördlichen Absonderung betroffen, kann ein Anspruch auf Ersatz des fortgezahlten Entgelts bestehen.
Wie wird der ersatzfähige Verdienstentgang des Selbständigen berechnet?
In welcher Höhe ein Verdienstentgang wegen behördlicher Absonderung ersetzt werden kann, ist anhand eines eigenen Berechnungsblattes zu ermitteln, das über die Website des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz abgerufen werden kann. Dieses Berechnungsblatt muss dem Antrag auf Ersatz des entgangenen Verdienstes jedenfalls vollständig ausgefüllt und von einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter bestätigt beigelegt werden.
Werden andere Unterstützungsleistungen angerechnet?
Anlässlich der Coronavirus-Pandemie bereits erhaltene oder zumindest beantragte Unterstützungsleistungen (z. B. aus dem Härtefallfonds oder einer Betriebsunterbrechungsversicherung) werden auf die Höhe des ersatzfähigen Verdienstentganges angerechnet, sofern diese auf den Zeitraum der durch die behördliche Absonderung eingetretenen Erwerbsbehinderung entfallen.
Können auch die Kosten der Antragstellung ersetzt werden?
Die Kosten der notwendigen Bestätigung des Berechnungsblattes durch einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter können bis zu einem Höchstbetrag von € 1.000,00 ersetzt werden.
Was gilt, wenn ein Arbeitnehmer behördlich abgesondert wird?
Grundsätzlich muss einem behördlich abgesonderten Arbeitnehmer das Entgelt für die Dauer der Absonderung weiterhin ausbezahlt werden. Der Arbeitgeber kann allerdings innerhalb von drei Monaten ab dem Ende der Absonderung bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft) den Ersatz des fortgezahlten Entgelts einschließlich des darauf entfallenden Dienstgeberanteils zur Sozialversicherung beantragen.
„Steuerliches Wohlverhalten“ als Bedingung für COVID-19-Förderungen des Bundes
Der Nationalrat hat ein Gesetz beschlossen, welches regelt, dass Unternehmen, denen eine Förderung des Bundes aufgrund der COVID-19-Pandemie gewährt wird, sich für einen Zeitraum von fünf Jahren vor der Antragstellung bis zum Abschluss der Förderungsgewährung (Endabrechnung) steuerlich wohlzuverhalten haben.
Unternehmen, die dies nicht tun, sind von der Gewährung von COVID-19-Förderungen des Bundes ausgeschlossen. Bereits erlangte Förderungen sind verzinst zurückzuzahlen.
Betroffen sind Förderungen (Zuschüsse) des Bundes aufgrund der COVID-19-Pandemie, die auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 Z 7 ABBAG geleistet werden.
Ein Unternehmen hat sich steuerlich wohlverhalten, wenn
-
beim Unternehmen in den letzten drei veranlagten Jahren kein rechtskräftig festgestellter Missbrauch im Sinne der Bundesabgabenordnung vorliegt, der zu einer Änderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage von mindestens € 100.000 im jeweiligen Veranlagungszeitraum geführt hat;
-
das Unternehmen in den letzten fünf veranlagten Jahren nicht mit einem Betrag von insgesamt mehr als € 100.000 vom Abzugsverbot des § 12 Abs. 1 Z 10 KStG oder von den Bestimmungen des § 10a KStG betroffen gewesen ist. Steuerliches Wohlverhalten liegt ebenfalls vor, wenn das Unternehmen bereits bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung den entsprechenden Anwendungsfall offengelegt, den erfassten Betrag hinzugerechnet hat und dieser € 500.000 nicht übersteigt;
-
das Unternehmen keinen Sitz oder keine Niederlassung in einem Staat hat, der in der EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke genannt ist, und dort im ersten nach dem 31. Dezember 2018 beginnenden Wirtschaftsjahr nicht überwiegend Passiveinkünfte im Sinne des § 10a Abs. 2 KStG erzielt;
-
über den Antragsteller oder dessen geschäftsführende Organe in den letzten fünf Jahren keine rechtskräftige Finanzstrafe oder Verbandsgeldbuße aufgrund von Vorsatz verhängt worden ist. Steuerliches Wohlverhalten liegt jedoch vor, sofern es sich um eine Finanzordnungswidrigkeit oder eine Finanzstrafe bzw. Verbandsgeldbuße bis € 10.000 handelt.
Wurde eine COVID-19-Förderung an ein Unternehmen ausgezahlt, das sich steuerlich nicht wohlverhalten hat, und erlangt die Förderstelle innerhalb von fünf Jahren ab Abschluss der Förderungsgewährung Kenntnis davon, wird die Förderung vollständig und verzinst zurückgefordert, sofern sich nichts anderes aus dem Fördervertrag oder unmittelbar anwendbarem EU-Recht ergibt.
Das Bundesgesetz trat mit 1. Jänner 2021 in Kraft und ist auf Förderungen anzuwenden, deren Rechtsgrundlage erstmals nach dem 31. Dezember 2020 in Kraft getreten ist.
Welche steuerlichen Änderungen sind im dritten Gesetzespaket zur Corona-Krise enthalten?
Der Gesetzgeber hat ein drittes Gesetzespaket zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen. Dieses umfasst unter anderem folgende steuerliche Änderungen (Auswahl):
Änderungen im Einkommensteuergesetz
- Steuerfreiheit der Zuwendungen zur Bewältigung der Corona-Krise. Hier sind Zuwendungen aus dem Krisenbewältigungsfonds, aus dem Härtefallfonds und aus dem Corona-Krisenfonds sowie vergleichbare Zuwendungen der Länder, Gemeinden und gesetzlichen Interessenvertretungen gemeint.
- Weitergewährung des Pendlerpauschales auch bei Corona-Kurzarbeit, vorübergehender Telearbeit und Dienstverhinderung. Ebenso sollen Zulagen und Zuschläge zum laufenden Arbeitslohn, der an den Arbeitnehmer im Fall einer Quarantäne, Telearbeit bzw. Kurzarbeit aufgrund der Corona-Krise weitergezahlt wird, weiterhin steuerfrei behandelt werden dürfen.
- Steuerbefreiung von Boni und Zulagen bis zu € 3.000, die 2020 an Beschäftigte für ihren Einsatz während der Corona-Krise gewährt werden.
- Kein Verlust des Hälftesteuersatzes für pensionierte Ärzte, die während der Corona-Krise erneut tätig werden.
Gebührengesetz
Erforderliche Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (beispielsweise bestimmte Bürgschaften und Mietverträge) wurden gebührenfrei gestellt.
Alkoholsteuergesetz
Im Alkoholsteuergesetz wurden steuerliche Erleichterungen bei der Herstellung von Desinfektionsmittel normiert.
Organisationsreform der Finanzverwaltung
Die Organisationsreform der Finanzverwaltung wird um ein halbes Jahr auf 1.1.2021 verschoben.
Fristenhemmung
Weitere Änderungen betreffen unter anderem die Hemmung bestimmter verfahrens- und finanzstrafrechtlicher Fristen.
Hinweis
Diese Informationen sind auf dem Stand vom 06.04.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie unter https://www.bmf.gv.at/public/informationen/informationen-coronavirus.html
Update Coronavirus: Was müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Schulschließungen beachten?
Der Arbeitgeber kann mit Arbeitnehmern, die für Kinder unter 14 Jahren betreuungspflichtig sind, eine Dienstfreistellung im Ausmaß von bis zu drei Wochen vereinbaren („Sonderbetreuungszeit“). Im Falle einer solchen Vereinbarung erhält der Arbeitgeber bis zum Beginn der Osterferien ein Drittel der währenddessen anfallenden Lohnkosten (begrenzt mit der ASVG-Höchstbemessungsgrundlage) ersetzt. Der Ersatz muss innerhalb von sechs Wochen ab Aufhebung der Schulschließungen bei der zuständigen Abgabenbehörde beantragt werden.
Voraussetzung ist dabei, dass die Arbeitsleistung des betroffenen Arbeitnehmers nicht für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig ist und kein Anspruch auf Dienstfreistellung zur Betreuung des Kindes besteht.
Ohne eine solche Vereinbarung kann die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren ein persönlicher Dienstverhinderungsgrund sein, wenn keine anderen Betreuungsmöglichkeiten gegeben sind. In diesem Fall darf der Arbeitnehmer zwar fernbleiben, behält seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung aber grundsätzlich nur für die Dauer von bis zu einer Woche.
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 06.04.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz .
Haben Selbstständige einen Anspruch auf Arbeitslosengeld?
Die Gruppe der Selbstständigen ist nicht in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert, sondern kann sich nur freiwillig versichern lassen. Selbstständige, die diese Möglichkeit nicht nutzen, können unter Umständen aber trotzdem einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, falls sie ihre selbstständige Tätigkeit einstellen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus kann diese soziale Absicherung gerade für EPU entscheidend sein.
Voraussetzung ist dabei jedenfalls, dass der Selbstständige vor seiner selbstständigen Tätigkeit als unselbstständig Beschäftigter arbeitslosenversichert war und dadurch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben hat.
Der einmal erworbene Anspruch auf Arbeitslosengeld bleibt unbefristet erhalten, wenn
- die selbstständige Tätigkeit vor dem 01.01.2009 begonnen wurde, und zwar unabhängig davon, wie lange der Selbstständige arbeitslosenversichert war, oder
- die selbstständige Tätigkeit nach dem 01.01.2009 begonnen wurde und der Selbstständige mindestens fünf Jahre lang in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert war.
Wenn die selbstständige Tätigkeit nach dem 01.01.2009 begonnen wurde und der Selbstständige weniger als fünf Jahre lang arbeitslosenversichert war, bleibt der Anspruch auf Arbeitslosengeld zwar grundsätzlich nur für fünf Jahre erhalten. Diese Frist verlängert sich aber um die Dauer der selbstständigen Tätigkeit.
Um Arbeitslosengeld beziehen zu können, muss die selbstständige Tätigkeit eingestellt werden. Der Selbstständige muss eine bestehende Gewerbeberechtigung zumindest ruhend melden und sich bei der SVS abmelden. Dabei kann die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit mitunter erhebliche steuer- und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen haben, weshalb im Vorfeld dringend individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater in Anspruch genommen werden sollte. Dabei ist ebenfalls abzuklären, ob die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelfall überhaupt erfüllt sind. Bevor die selbstständige Tätigkeit eingestellt wird, muss aber unbedingt geprüft werden, ob sich die Liquidität nicht auch durch andere Maßnahmen, etwa durch Förderungen, sicherstellen lässt.
Unterstützungspaket der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) für Exporteure
Angesichts der Coronakrise stellt die Österreichische Kontrollbank AG (OeKB) im Auftrag des Bundesministeriums Finanzen österreichischen Exporteuren folgendes Unterstützungspaket zur Verfügung.
Eckpunkte:
- Exportunternehmen können einen Kreditrahmen in Höhe von 10 Prozent (Großunternehmen) bzw. 15 Prozent (Klein- und Mittelunternehmen) ihres Exportumsatzes bei der OeKB beantragen. Absolute Obergrenze für den Einzelkredit: € 60 Mio. pro Firmengruppe, keine Untergrenze.
- Nicht relevant ist, ob das jeweilige Unternehmen bisher schon Kunde bei der OeKB ist und ob ein etwaiger bestehender Kreditrahmen bereits ausgeschöpft ist.
- Insgesamt umfasst der ab sofort zur Verfügung stehende Kreditrahmen zwei Milliarden Euro.
- Die Finanzierungen sind vorerst auf zwei Jahre befristet, mit der Möglichkeit, diese danach zu verlängern.
- Voraussetzung (unter anderem): Nachweis einer bestehenden Exporttätigkeit und dass das Unternehmen bis zum Start der COVID-19-Auswirkungen in Österreich wirtschaftlich gesund war.
- Der Bund ist bereit, Haftungen für 50 bis 70 Prozent dieser Kredite zu übernehmen.
- Antrag über die Hausbank.
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 19.03.2020 und können sich kurzfristig ändern.
Maßnahmenpaket der Österreichischen Hotel und Tourismusbank (ÖHT) für den Tourismus
Das Bundesministerium Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat anlässlich der Coronakrise gemeinsam mit der Österreichischen Hotel und Tourismusbank (ÖHT) ein Maßnahmenpaket für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Tourismus- und Freizeitwirtschaft geschnürt. Überbrückungsfinanzierungen der Hausbanken können mit Haftungen der ÖHT besichert werden und es erfolgt eine Kostenübernahme der einmaligen Bearbeitungsgebühr und der Haftungsprovision.
Eckpunkte:
- Sowohl aktivierungs- als auch nicht aktivierungspflichtige Kosten werden gefördert (insbesondere all jene Kosten, welche zu Liquiditätsengpässen auf betrieblicher Ebene führen)
- Bundeshaftung in Höhe von 80 % zur Besicherung neu aufzunehmender Überbrückungskredite (Kontokorrentkredite)
- keine Untergrenze der Haftungssumme; maximal kann eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von € 500.000 mit einer Bundeshaftungsquote in Höhe von 80 % besichert werden (maximale Haftungssumme also € 400.000)
- für die ÖHT Haftung sind keine Sicherheiten beizubringen
- Rückzahlungsmodalitäten sind zwischen Unternehmer und Hausbank grundsätzlich frei zu vereinbaren; Laufzeit der Bundeshaftung maximal 36 Monate
- ein erwarteter Rückgang der Umsatzerlöse von mindestens 15 % gegenüber dem Vorjahr muss vorliegen bzw. prognostiziert werden
- Bearbeitungsgebühr und laufende Haftungsprovision werden vom Bund übernommen
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 19.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen, weitere Voraussetzungen, Details, notwendige Unterlagen und Informationen zur Antragstellung finden Sie auf der Website der ÖHT https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/.
AWS-Überbrückungsgarantien werden ausgeweitet
Das Austria Wirtschaftsservice (aws) weitet seine Überbrückungsgarantien im Zusammenhang mit der COVID-19 – Krise aus und nimmt Vereinfachungen vor.
Eine aws-Garantie ist grundsätzlich:
- eine Garantie der Republik Österreich
- zugunsten eines österreichischen Unternehmens
- an die Bank
- für die Rückzahlung des aufgenommenen Kredits
- im Ausmaß einer bestimmten Garantiequote
- für den Fall, dass das Unternehmen insolvent wird.
Eckpunkte:
- gefördert werden Betriebsmittelfinanzierungen (z.B. Wareneinkäufe, Personalkosten) sowie Finanzierungen für die Stundung von bestehenden Kreditlinien
- an gesunde Unternehmen (keine Tourismusunternehmen -> eigene Förderung über ÖHT), die aufgrund der gegenwärtigen „Coronavirus-Krise“ über keine oder nicht ausreichende Liquidität zur Finanzierung des laufenden Betriebes verfügen bzw. deren Umsatz- und Ertragsentwicklung durch Auftragsausfälle oder Marktänderungen beeinträchtigt ist
- die Garantielaufzeit beträgt maximal 5 Jahre
- unterstützt werden bis zu 80 % eines Kredites von bis zu € 2,5 Mio pro KMU (inkl. Verflechtungen)
- keine Kreditsicherheiten erforderlich (auch keine persönliche Haftung der Eigentümer)
Ab sofort wird die aws-Überbrückungsgarantie deutlich ausgebaut und vereinfacht:
- Verzicht auf die Verrechnung von Bearbeitungs- und Garantieentgelten
- Keine Planungsrechnungen oder Businesspläne erforderlich
- Keine Kreditsicherheiten erforderlich
- Freiberufliche Tätigkeiten sind ab sofort garantiefähig
- Garantien sind auch für die Stundung von bestehenden Kreditlinien verwendbar
- Es wird ein beschleunigtes Verfahren eingeführt, das eine umgehende Garantiezusage ermöglicht.
Alle Ausweitungsmaßnahmen greifen grundsätzlich ab sofort (Ausnahme Schnellverfahren) und betreffen auch die bereits gestellten Förderungsanträge.
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 19.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen, weitere Voraussetzungen, Details, die entsprechende Garantierichtlinie und die Informationen zu den erforderlichen Unterlagen finden Sie unter https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/.
CORONAVIRUS: Erleichterungen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)
Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) informiert am 23.3.2020 über folgende Zahlungserleichterungen für österreichische Betriebe:
Stundungen für die Beitragszeiträume Februar, März und April 2020:
- Für Betriebe, die von der „Schließungsverordnung“ oder einem Betretungsverbot nach dem Epidemiegesetz betroffen sind, erfolgt eine automatische Stundung der Beiträge.
- Sonstige Betriebe mit coronabedingten Liquiditätsproblemen können bei der ÖGK um Ratenzahlung oder Stundung ansuchen. Der formlose Antrag hat die coronabedingten Probleme zu beinhalten und ist an die jeweilige regionale Servicestelle zu richten.
- Für die Dauer der Stundung fallen keine Verzugszinsen an.
Aussetzen der Einbringungsmaßnahmen in den Monaten März, April und Mai 2020:
- In diesen Monaten erfolgen generell keine Einbringungsmaßnahmen wie Exekutionsanträge etc.
- Es werden keine Insolvenzanträge gestellt.
- Für coronabedingt verspätete Beitragsgrundlagenmeldungen werden keine Säumniszuschläge vorgeschrieben.
An einer möglichst unbürokratischen Antragseinbringung und Abrechnung wird seitens der ÖGK gearbeitet. Für Unternehmen soll nichts verloren gehen, wenn die entsprechenden Anträge nicht umgehend eingebracht werden.
Die Grundregeln der Lohnverrechnung bleiben weiterhin aufrecht:
- Die gesetzliche Fälligkeit der Beiträge bleibt bestehen
- Die Anmeldungen zur Pflichtversicherung müssen weiterhin fristgerecht vor Arbeitsantritt erfolgen.
- Die monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen sind unbedingt rechtzeitig zu übermitteln.
Hinweis
Diese Informationen sind auf dem Stand vom 23.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Aktuelle Detailinformationen finden Sie unter https://www.gesundheitskasse.at.
CORONAVIRUS: Angebote der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)
Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bietet auf Ihrer Homepage (https://www.svs.at) den SVS-Versicherten bei Bedarf aufgrund des Coronavirus folgende Möglichkeiten:
- Stundung oder Ratenzahlung der Beiträge, wenn Zahlungsschwierigkeiten durch die Coronakrise bedingt sind (eigene Erkrankung, Quarantäne, Umsatzeinbruch in einschlägigen Branchen z.B. Veranstaltungssektor, Gastronomie, Hotellerie). Das Zahlungsziel orientiert sich primär nach dem Wunsch des Versicherten und der Dauer der Krise. Beantragung per E-Mail an vs@svs.at
- Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage aufgrund einer Coronavirus-bedingten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Beantragung per Online-Formular oder E-Mail an vs@svs.at.
- Aussetzung der Eintreibungsmaßnahmen: Mahnungen von offenen Beitragsforderungen werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Von Anträgen auf Einleitung von Exekutionsverfahren sowie Insolvenzverfahren wird Abstand genommen.
Hinweis
Diese Informationen sind auf dem Stand vom 23.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Aktuelle Detailinformationen finden Sie unter https://www.svs.at.
CORONAVIRUS: Sonderregelungen des Finanzministeriums
Das Finanzministerium hat in einer eigenen BMF-Info die aktuellen Sonderregelungen betreffend des Coronavirus dargestellt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu diesen Regelungen.
Voraussetzungen
Voraussetzung für alle Maßnahmen ist, dass der Steuerpflichtige glaubhaft machen kann, dass er von einem Liquiditätsengpass betroffen ist, der konkret auf eine Corona-Virus-Infektion zurückzuführen ist. Dazu zählen zB außergewöhnlich hohe Stornierungen von Hotelreservierungen, Ausfall von Sport- und Kulturveranstaltungen aufgrund behördlicher Verbote, Ausfall oder Beeinträchtigung von Lieferketten oder Ertragseinbußen durch Änderung des Konsumverhaltens. Für die Glaubhaftmachung können unbürokratisch Textbausteine aus der BMF-Info verwendet werden. Die unten dargestellten Anträge und Anregungen sind seitens der Finanz sofort zu erledigen.
Einkommensteuer- oder Körperschafsteuervorauszahlungen für das Jahr 2020
Steuerpflichtige, die von einer durch das Coronavirus bedingten Ertragseinbuße betroffen sind, können einen Antrag auf Herabsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 2020 stellen. Im Antrag muss die konkrete Betroffenheit glaubhaft gemacht werden.
Wird der Steuerpflichtige von den Folgen des durch das Corona-Virus ausgelösten Notstandes liquiditätsmäßig derart betroffen, dass er die Vorauszahlung festzusetzenden Höhe nicht bezahlen kann, kann er bei seinem Finanzamt anregen, die Einkommensteuer- oder die Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 2020 zur Gänze nicht festzusetzen oder die Festsetzung auf einen Betrag zu beschränken, der niedriger ist, als die voraussichtliche Jahressteuer 2020.
Das Finanzamt hat zudem von einer Festsetzung von Nachforderungszinsen von Amts wegen Abstand zu nehmen, wenn aus der Herabsetzung oder dem Wegfall der Vorauszahlungen bei der (nach Ablauf des Jahres 2020 erfolgenden) Veranlagung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer für2020 Nachforderungszinsen resultieren.
Abgabeneinhebung
Das Finanzamt hat bei der Bearbeitung von Stundungs- und Ratenansuchen auf die besondere Situation, die im Einzelfall durch das Auftreten des Corona-Virus entstanden ist, entsprechend Bedacht zu nehmen. Der Steuerpflichtige kann in diesen Fällen zudem bei seinem Finanzamt (zB im Antrag auf Stundung oder Ratenzahlung) anregen, von der Festsetzung von Stundungszinsen abzusehen.
Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt beantragen, einen verhängten Säumniszuschlag herabzusetzen oder nicht festzusetzen. Das Finanzamt hat bei der Erledigung des Antrags des Steuerpflichtigen auf Herabsetzung bzw. Nichtfestsetzung eines Säumniszuschlages davon auszugehen, dass kein grobes Verschulden an der Säumnis vorliegt, wenn die konkrete Betroffenheit vom Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wurde.
Das Finanzministerium hat nun auf seiner Homepage auch einen kombinierten Antrag zu Sonderregelungen betreffend Coronavirus zur Verfügung gestellt: https://www.bmf.gv.at/public/
CORONAVIRUS: Erleichterungen der Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK)
Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) informiert auf ihrer Homepage ( https://www.gesundheitskasse.at) über unbürokratische Erleichterungen für Dienstgeber:
Stundung der Beiträge
Die maximale Stundungsdauer kann von ein auf drei Monate verlängert werden bei Liquiditätsengpässen, wenn diese auf die aktuelle Situation zurückzuführen sind.
Ratenzahlung der Beiträge
Die Ratendauer kann auf bis zu 18 Monate verlängert werden.
Nachsicht bei Säumniszuschlägen
Kommt es zu Meldeverspätungen, die auf Auswirkungen des Coronavirus zurückzuführen sind, so können diese auf Antrag nachgesehen werden.
Aussetzen von Exekutionsanträgen und Insolvenzanträgen
Sind Liquiditätsengpässen bedingt durch das Coronavirus können im Einzelfall Exekutionsanträge und Insolvenzanträge aufgeschoben werden. Auch besondere Sicherstellungen sind dazu nicht erforderlich.
CORONAVIRUS: Angebote der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)
Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bietet auf Ihrer Homepage (https://www.svs.at) den SVS-Versicherten bei Bedarf aufgrund des Coronavirus folgende Möglichkeiten:
- Stundung der Beiträge (Online-Formular)
- Ratenzahlung der Beiträge (Online-Formular)
- Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage (Online-Formular)
- Gänzliche bzw. teilweise Nachsicht der Verzugszinsen
Coronavirus: Was muss der Arbeitgeber berücksichtigen?
Die Ausbreitung des Coronavirus wirft zahlreiche arbeitsrechtliche Fragen auf. Hier eine Auswahl dazu:
Muss der Arbeitnehmer eine Ansteckung bekannt geben?
Weil die Ansteckung mit dem Coronavirus nach dem Epidemiegesetz meldepflichtig ist, wird davon auszugehen sein, dass der betroffene Arbeitnehmer auch den Arbeitgeber darüber informieren muss.
Kann der Arbeitgeber Home-Office anordnen?
Der Arbeitgeber kann die Arbeitsleistung am Wohnsitz des Arbeitnehmers („Home Office“) nur aufgrund eines Versetzungsvorbehaltes oder einer diesbezüglichen Vereinbarung im Arbeitsvertrag einseitig anordnen. In allen anderen Fällen muss der Arbeitnehmer einer Beschäftigung an seinem Wohnsitz erst zustimmen.
Kann der Arbeitgeber Zeitausgleich oder Urlaub anordnen?
Der Arbeitgeber kann Urlaub und Zeitausgleich nicht einseitig anordnen, sondern muss dazu eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer treffen. Ohne dessen Einwilligung kann der Arbeitnehmer nur unter Fortzahlung des Entgelts dienstfrei gestellt werden.
Wie wirken sich die aktuellen Ausgangsbeschränkungen aus?
Die von der Bundesregierung verfügten Ausgangsbeschränkungen sehen eine Ausnahme für berufliche Zwecke vor. Der Aufenthalt am Arbeitsort und der Arbeitsweg sind damit grundsätzlich zwar gerechtfertigt, die Arbeitgeber sind aber dennoch dazu angehalten, ihre Arbeitnehmer möglichst an deren Wohnsitz zu beschäftigen.
Darf der Arbeitnehmer aus Angst vor einer Ansteckung fernbleiben?
Ohne die objektiv drohende Gefahr einer Ansteckung am Arbeitsplatz (z.B. Krankheitsfall im unmittelbaren Arbeitsumfeld) darf der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung nicht verweigern. Bleibt der Arbeitnehmer ohne Rechtfertigung von der Arbeit fern, verletzt er dadurch seine Dienstpflichten und verwirklicht mitunter einen Entlassungsgrund.
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 16.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website des Bundesministeriums Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
Coronavirus: Wann muss das Entgelt weiter ausbezahlt werden?
Die Dienstverhinderung wegen einer Erkrankung am Coronavirus ist arbeitsrechtlich ein normaler Krankenstand. Der erkrankte Arbeitnehmer behält deshalb für die gesetzliche Dauer seinen Anspruch auf Ausbezahlung des Entgelts durch den Arbeitgeber („Entgeltfortzahlung“). Zur Entlastung können Arbeitgeber, die im Durchschnitt höchstens 50 Arbeitnehmer beschäftigen, ab dem elften Tag der Entgeltfortzahlung bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt einen Zuschuss beantragen.
Bei einer behördlich angeordneten Quarantäne wegen Ansteckungsverdacht handelt es sich hingegen um keinen Krankenstand, sondern um eine sonstige Dienstverhinderung.
Besteht während einer Quarantäne ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Für die Dauer einer behördlich angeordneten Quarantäne im Inland muss der Arbeitgeber gemäß Epidemiegesetz einen Vergütungsbetrag in Höhe des regelmäßig gebührenden Entgelts an den betroffenen Arbeitnehmer ausbezahlen. Nach dem Ende der Quarantäne kann der Arbeitgeber innerhalb von sechs Wochen bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde die Erstattung der ausbezahlten Vergütungsbeträge (einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung) beantragen.
Die Quarantäne im Ausland wird regelmäßig eine Dienstverhinderung aus einem anderen wichtigen Grund sein. Ob und wie lange in einem solchen Fall ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, muss anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalles beurteilt werden.
Wie wirkt sich eine Betriebsschließung aus?
Die inzwischen verfügten Betretungsverbote bedeuten für zahlreiche Arbeitgeber der Handels- und Dienstleistungsbranche eine faktische Schließung des Betriebs. Da es sich dabei aber um keine Maßnahme nach dem Epidemiegesetz handelt, greifen die darin vorgesehenen Ansprüche des Arbeitgebers nicht. Stattdessen wird ein Krisenbewältigungsfonds zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft eingerichtet. Wie und unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber finanzielle Mittel aus diesem Fonds abrufen wird können, muss allerdings noch abgewartet werden.
Muss das Entgelt bei der Dienstverhinderung aus einem anderen Grund weiter ausbezahlt werden?
Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung kann auch dann bestehen, wenn der Arbeitnehmer aus einem anderen, mit der Verbreitung des Coronavirus zusammenhängenden Grund (z.B. Verkehrsbehinderungen) ohne eigenes Verschulden an der Arbeitsleistung gehindert ist. In einem solchen Fall ist das Entgelt grundsätzlich für die Dauer von einer Woche (in begründeten Einzelfällen auch länger) weiter auszuzahlen.
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 16.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website des Bundesministeriums Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
Coronavirus: Was müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Schulschließungen beachten?
Der Arbeitgeber kann mit Arbeitnehmern, die für Kinder unter 14 Jahren betreuungspflichtig sind, eine Dienstfreistellung im Ausmaß von bis zu drei Wochen vereinbaren („Sonderbetreuungszeit“). Im Falle einer solchen Vereinbarung erhält der Arbeitgeber bis zum Beginn der Osterferien ein Drittel der währenddessen anfallenden Lohnkosten (begrenzt mit der ASVG-Höchstbemessungsgrundlage) ersetzt. Der Ersatz muss innerhalb von sechs Wochen ab Aufhebung der Schulschließungen bei der zuständigen Abgabebehörde beantragt werden.
Ohne eine solche Vereinbarung kann die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren ein persönlicher Dienstverhinderungsgrund sein, wenn keine anderen Betreuungsmöglichkeiten gegeben sind. In diesem Fall darf der Arbeitnehmer zwar fernbleiben, behält seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung aber grundsätzlich nur für die Dauer von bis zu einer Woche.
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 16.03.2020 und können sich kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website des Bundesministeriums Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
EHC Wirtschaftstreuhandgesellschaft GmbH
Schulgasse 10
2000 Stockerau, Österreich
+43 (0) 2266 / 628 70-0
+43 (0) 2266 / 628 70-51
office∂ehc-wt.com
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag:
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
12.30 Uhr - 15.00 Uhr
Freitag:
8.00 Uhr - 12.00 Uhr